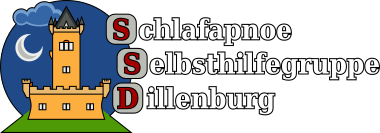Mit Diabetes mellitus, allgemein als Zuckerkrankheit bekannt, wird medizinisch eine Gruppe von Stoffwechselerkrankungen bezeichnet, die durch einen erhöhten Blutzucker gekennzeichnet ist.
Es werden der Typ 1-Diabetes und der Typ 2-Diabetes unterschieden.
Der Typ 1-Diabetes entsteht meist akut auftretend im Kindes- oder Jugendalter als Folge der Zerstörung der Insulin, Glucagon (und Somatostatin) bildenden Langerhansschen Inseln (inselartig Zellgruppe auf der Bauchspeicheldrüse, griechisch Pankreas), die den Kohlenhydratstoffwechsel steuern.
Als Ursache kommen neben erblichen Faktoren auch Infekte und andere unbekannte Faktoren in Betracht.
1. Der Typ 2-Diabetes entwickelt sich langsam als Folge zunehmender Unempfindlichkeit der Zellen gegenüber dem Insulin. Da dieser Diabetes-Typ generell ab dem etwa 40. Lebensjahr auftritt wird er auch als Erwachsenen- oder Altersdiabetes bezeichnet. Sowohl eine ungesunde Nahrungsaufnahme als auch Übergewicht und Bewegungsmangel lösen bei Vorliegen einer genetischen Veranlagung dieses Krankheitsbild aus und es sind immer öfter jüngere Personen bis hin zu Kindern betroffen.
Die Klassifikation des Diabetes mellitus erfolgt seit 1998 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und seit 2000 von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft e.V. (DDG) nach folgendem Schema:
I. Typ 1 Diabetes
Typ 1A Immunologisch vermittelte Form
Typ 1B Idiopathische Form (ohne erkennbare Ursache) In Europa seltene Form
1. Typ 1 Diabetes wird meistens im Kindes- Jugend- oder jungem Erwachsenenalter erkennbar.
2. Beginnt meist mit plötzlich einsetzenden Beschwerden und Symptomen.
3. Typische Symptome: Müdigkeit, Gewichtsverlust, gesteigertes Durstgefühl, vermehrte
4. Ausgeprägte Ketoseneigung (Acetonausscheidung im Urin).
5. Vermindertete bis fehlende Insulinsekretion (Insulinausschüttung).
6. Keine oder nur geringe Insulinresistenz (Insulinunempfindlichkeit).
7. Famili?re H?ufung gering. Bei eineiigen Zwillingen 30-50 %..
8. HLA-Assoziation vorhanden (HLA = Human Leukocyte Antigen).
9. Diabetesassoziierte Antikörper: ca. 90-95 % bei Manifestation.
3
10. Labiler Stoffwechsel.
11. Ansprechen auf Ä-zytotrope Antidiabetika meist fehlend.
12. Insulintherapie erforderlich
II. Typ 2 Diabetes
1. Typ 2 Diabetes tritt bevorzugt im mittleren bis höheren Erwachsenenalter (Altersdiabetes) auf.
2. Beginnt meist schleichend.
3. Tritt meistens ohne Beschwerden auf.
4. Fehlende oder nur geringe Ketoseneigung (Acetonausscheidung im Urin).
5. Subnormale bis hohe Insulinsekretion (Insulinausschüttung). Qualitativ immer gestört.
6. Oft ausgeprägte Insulinresistenz (Insulinunempfindlichkeit).
7. Familiäre Häufung typisch. Bei eineiigen Zwillingen über 90 %.
8. HLA-Assoziation nicht vorhanden (HLA = Human Leukocyte Antigen).
9. Diabetesassoziierte Antikörper: keine.
10. Stabiler Stoffwechsel.
11. Ansprechen auf Ä-zytotrope Antidiabetika zunächst meist gut.
12. Insulintherapie meist erst nach jahrelangem Verlauf der Erkrankung mit Nachlassen der Insulinsekretion.
III. Andere spezifische Diabetes-Typen
A Genetische Defekte der B-Zell-Funktion
B Genetische Defekte der Insulinwirkung
C Erkrankungen des exokrinen Pankreas (Bauchspeicheldrüse)
D Endokrinopathien (hormonelle Störungen)
E Medikamenten- oder chemikalienindiziert
F Infektionen
G Seltene Formen des immunvermittelten Diabetes
H Andere, gelegentlich mit Diabetes assoziierte genetische Syndrome
IV. Gestationsdiabetes (Schwangerschaftsdiabetes. Tritt in 1-5 % aller Schwangerschaften auf)