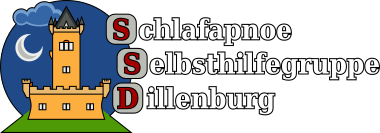Bei Ärzten zählt der akademische Titel
Ärzte sollte man mit ihrem akademischen Titel ansprechen. Ob Sie nun „Guten Tag, Herr Doktor“ sagen oder den Namen hinzufügen („Guten Tag, Herr Doktor Müller“), kann nach einer Verlautbarung der Bundesärztekammer jeder Patient selbst entscheiden: „Hauptsache, beide Seiten gehen respektvoll miteinander um.“ Ist der Doktor auch ein Professor, wird immer der höchste Abschluss als Anrede genommen – in diesem Fall also der Professor, der Doktor fällt weg.
Den Doktortitel bei der Ansprache unaufgefordert wegzulassen, ist ein Privileg unter Kollegen und sollte von anderen vermieden werden. Schließlich drückt die Nennung des Titels auch den Respekt vor der wissenschaftlichen Leistung aus. Im Krankenhaus ist es nicht nötig, „Herr Oberarzt“ zu sagen, es reicht, wenn der akademische Titel genannt wird. Das Gleiche gilt natürlich für den Chefarzt, wenn Sie ihn je zu sehen bekommen.
Und wenn der Arzt kein Doktor ist?
Nun gibt es auch Ärzte, die auf dem Praxisschild kein „Dr. med.“ stehen haben oder die als „Dipl.-Med.“ ausgewiesen sind. Sie können dann als Patient bei seinem Nachnamen bleiben und streng nach der Etikette den „Doktor“ weglassen.
Aber kein anderer Beruf ist so eng mit dem akademischen Titel verknüpft wie der des Arztes oder der Ärztin. Daher werden auch nichtpromovierte Ärzte aus Gewohnheit oft mit „Frau Doktor“ oder „Herr Doktor“ angesprochen. Und wenn das in einer Praxis am Tag 50-mal passiert und der Arzt das jedes Mal korrigieren würde, würde die Wartezeit in der Sprechstunde erheblich ansteigen – und das wäre auch nicht gerade ein Ausdruck von Höflichkeit.
Approbation auch ohne Doktortitel
Unter der Approbation versteht man die staatliche Erlaubnis, die Berufsbezeichnung Arzt zu führen, weil man dank seiner Ausbildung in der Lage ist, den Beruf eigenverantwortlich und selbstständig auszuführen.
Doktortitel – Bedeutung der Abkürzungen
D.; D. theol. (theologiae)
ehrenhalber verliehener Doktortitel der protestantischen Theologie
Dr. agr. (agronomiae)
Doktor der Landwirtschaft und Bodenkultur
Dr. cult. (culturae)
Doktor der Kulturwissenschaft
Dr. des. (designatus)
Doktor zwischen Prüfung und Aushändigung der Promotionsurkunde
Dr. diac. (diaconiae)
Doktor der Diakoniewissenschaften
Dr. disc. pol. (disciplinae politicarum)
Doktor der Sozialwissenschaft
Dr. forest. (forestalium)
Doktor der Forstwissenschaft
Dr. … habil. (habilitatus)
Doktor, der die Lehrberechtigung (venia legendi) an Hochschulen erworben hat. Je nach Bundesland wird auch der Zusatz Privatdozent (PD) vorangestellt.
(Mit einer Habilitation (habil.) weisen Ärzte ihre Lehrbefähigung nach und können sich um eine Professur an einer Hochschule bewerben. Der akademische Titel hierfür ist Dr. med. habil.
Die Abkürzung PD steht für Privatdozent. Mit PD Dr. med. wird ein habilitierter Arzt bezeichnet, der die Lehrberechtigung an Universitäten erworben hat, Professor werden will und an der Uni Lehrveranstaltungen gibt.
Dr. h.c. (honoris causa)
aufgrund besonderer wissenschaftlicher oder kultureller Leistungen ehrenhalber verliehener Doktortitel, ohne Ableistung einer wissenschaftlichen Prüfung (Ehrendoktor – kein akademischer Grad)
Dr. h.c. mult. (honoris causa multiplex)
mehrfacher Ehrendoktor; auch: Dr. e.h.
(ehrenhalber – keine akademischen Grade)
Dr.-Ing. (Ingenieur)
Doktor der Ingenieurwissenschaft
Dr. iur. can. (iuris canonici)
Doktor der kanonischen Rechtswissenschaften
Dr. iuris. utr. (iuris utriusque)
Doktor beider Rechte (weltliches und kirchliches)
Dr. jur. (iur) oder (iuris)
Doktor der Rechtswissenschaft
Dr. math. (mathematicarum)
Doktor der Mathematik
Dr. med. (medicinae)
Doktor der Medizin
(Dr. med.: Im Anschluss an das medizinische Staatsexamen oder das medizinische Diplom (zu Zeiten der ehemaligen DDR von 1971-1990) wurde an einer Universität dieser medizinische Dr.-Titel erworben (promoviert).
Wenn Absolventen eines Dr. med. dent. (Zahnmedizin) oder Dr. med. univ. den österreichischen Dr. scient. med. erwerben, wird kein zusätzlicher Doktorgrad vergeben sondern „et scient. med.“ hinzugefügt. Also: Dr. med. univ. et scient. med. und Dr. med. dent. et scient. med.
Dr. med. univ. (medicinae universae), (österr.): Doktor der gesamten Medizin, wird durch ein Diplomstudium erworben.
Dr. med. dent. (medicinae dentariae)
Doktor der Zahnheilkunde
Dr. med. vet. (medicinae veterinariae)
Doktor der Tierheilkunde
Dr. medic
Die Promotion zum Doctor rerum medicarum (Dr. rer. medic.) richtet sich an Nicht-Mediziner*innen und Nicht-Zahnmediziner*innen, die in einem Fachgebiet der Medizin oder einem medizinnahen Fachgebiet promovieren möchten.
Dr. mult. (multiplex)
Doktor mit mehreren Doktortiteln Dr. mult.: mult. steht für multiplex. Das bedeutet, dass der Doktor mehrere Doktortitel hat.
Dr. oec. (oeconomiae)
Doktor der Verwaltungswissenschaften
Dr. oec. publ. (oeconomiae publicae)
Doktor der Staatswissenschaft
Dr. oec. troph. (oecotrophologiae)
Hauswirtschaft, Ernährungswissenschaften
Dr. P. H. (Public Health)
Doktor der Gesundheitswissenschaften
Dr. paed. (paedagogiae)
Doktor der Pädagogik
Dr. pharm. (pharmaciae)
Doktor der Arzneimittelkunde
Dr. phil. (philosophiae)
Doktor der Philosophie
Dr. phil. nat. (philosophiae naturalis)
Doktor der Naturwissenschaften
Dr. rer. agr. (rerum agriculturarum)
Doktor der Landwirtschaft und Bodenkultur
Dr. rer. biol. hum. (rerum biologicarum humanarum)
Doktor der Humanwissenschaften / Humanbiologie oder auch:
Dr.rer. biol. hum. h.c. Ehrendoktorwürde
Dr. rer. comm. (rerum commercialium)
Doktor der Handelwissenschaften
Dr. rer. cur. (rerum curae)
Doktor der Pflegewissenschaft
Dr. rer. hort. (rerum horticulturarum)
Doktor der Gartenbaukunde
Dr. rer. med.: Doktor der Medizin mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt.
Dr. rer. medic. (rerum medicinalium)
Doktor der Theoretischen Medizin steht für Doctor rerum medicinalium und bezeichnet einen Doktor der Gesundheitswissenschaften.
Dr. rer. merc. (rerum mercantilium)
Doktor der Handelswissenschaft
Dr. rer. mont. (rerum montanarum)
Doktor der Bergbauwissenschaft
Dr. rer. nat. (rerum naturalium)
Doktor der Naturwissenschaft
Dr. rer. oec. (rerum oeconomicarum)
Doktor der Wirtschaftswissenschaft
Dr. rer. publ. (rerum publicarum)
Doktor der Verwaltungswissenschaften
Dr. rer. pol. (rerum politicarum)
Doktor der Staatswissenschaft
Dr. rer. physiol. (rerum physiologicarum
Doktor der Humanbiologie oder:
Dr. rer. sec. (rerum securitatis)
Doktor der Sicherheitswissenschaften
Dr. rer. silv. (rerum silvestrium)
Doktor der Forstwissenschaften
Dr. rer. soc. (rerum sociologicae)
Doktor der Sozialwissenschaften
Dr. rer. techn. (rerum technicarum)
Doktor der technischen Wissenschaft
Dr. sc. agr. (scientiarum agrariculturae)
Doktor der Landwirtschaft und Bodenkultur
Dr. sc. hum. (scientiarum humanarum)
Doktor der Humanwissenschaften
(Der Titel Dr. sc. hum. steht für doctor scientiarum humanarum (Doktor der Humanwissenschaften).
Dr. scientiae musicae
Doktor der Musikwissenschaften
Als Dr. scient. med. wird ein Doktor der medizinischen Wissenschaft in Österreich bezeichnet. Dr. scient. med. ist vergleichbar mit dem Dr. med. in Deutschland.
Dr. sc. nat. (scientiarum naturalis)
Doktor der Naturwissenschaft
Dr. sc. paed. (scientiarum paedogogiae)
Doktor der Erziehungswissenschaft
Dr. sc. pol. (scientiarum politicarum)
Dr. sc. techn. (scientiarum technicarum)
Doktor der technischen Wissenschaft
Dr. Sportwiss.
Doktor der Sportwissenschaften
Dr. theol. (theologiae)
Doktor der Theologie
Dr. troph. (trophologiae)
Doktor der Ernährungswissenschaft
Dr. med. univ. et scient. med.: Dieser Titel wurde bis 2007 in Österreich verwendet und steht für Doktor der gesamten Heilkunde mit wissenschaftlicher Befähigung.
Dres. (doctores)
Abkürzung für Doktoren. Üblich bei gleichzeitiger Nennungen mehrerer Titelträger Wenn sich in einer Praxis mehrere promovierte Ärzte niederlassen, steht auf dem Praxisschild oft Dres. Das ist die Abkürzung vom lateinischen doctores. Das bedeutet Ärzte.
M.D. bedeutet Medical Doctor. Dieser Titel wird ohne Doktorarbeit (Promotion) mit dem Abschluss des Medizinstudiums beispielsweise in den USA, Großbritannien und Skandinavien vergeben
MUDr. und andere ausländische Dr.-Titel
Die Abkürzung MUDr. steht für medicinae universae doctor (Doktor der Medizin) und wird in Tschechien und der Slowakei vergeben. Der Titel wird dort nach Abschluss des Medizinstudiums verliehen, ohne zusätzliche Doktorarbeit (Promotion).
SR ist die Bezeichnung für Sanitätsrat. Der bis 1918 in Deutschland verliehene Ehrentitel für verdiente Ärzte ist seit 1945 wieder in einigen deutschen Bundesländern (zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und im Saarland) als Ehrung für besonders verdiente Mediziner eingeführt worden.
In der ehemaligen DDR wurde der Titel Sanitätsrat (SR) zur Würdigung verdienstvoller Tätigkeit im nichtstaatlichen Gesundheitswesen (ambulante medizinische Betreuung) an Ärzte und Zahnärzte verliehen. Voraussetzung war eine mindestens 20-jährige ärztliche oder zahnärztliche Tätigkeit.
Andere akademische Titel für Ärzte
Die Abkürzungen M. Sc. oder MSC oder M. S. stehen für Master of Science. Der Masterstudiengang kann in einer bestimmten medizinischen Fachrichtung oder in fachübergreifenden Disziplinen wie z.B. Medizintechnik oder Biomedizin abgeschlossen werden.
Die Abkürzung MHBA steht für Master of Health Business Administation. Ärzte erwerben in diesem Studiengang wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen für das Gesundheitswesen.
Den Master of Public Health, kurz MPH oder MSc Public Health kann ein Arzt nach seinem abgeschlossenen Medizinstudium im Aufbaustudiengang erwerben.
MBA steht für Master of Business Administration und ist ein Management-Studium, was dem Medizin-Erststudium angeschlossen werden kann.